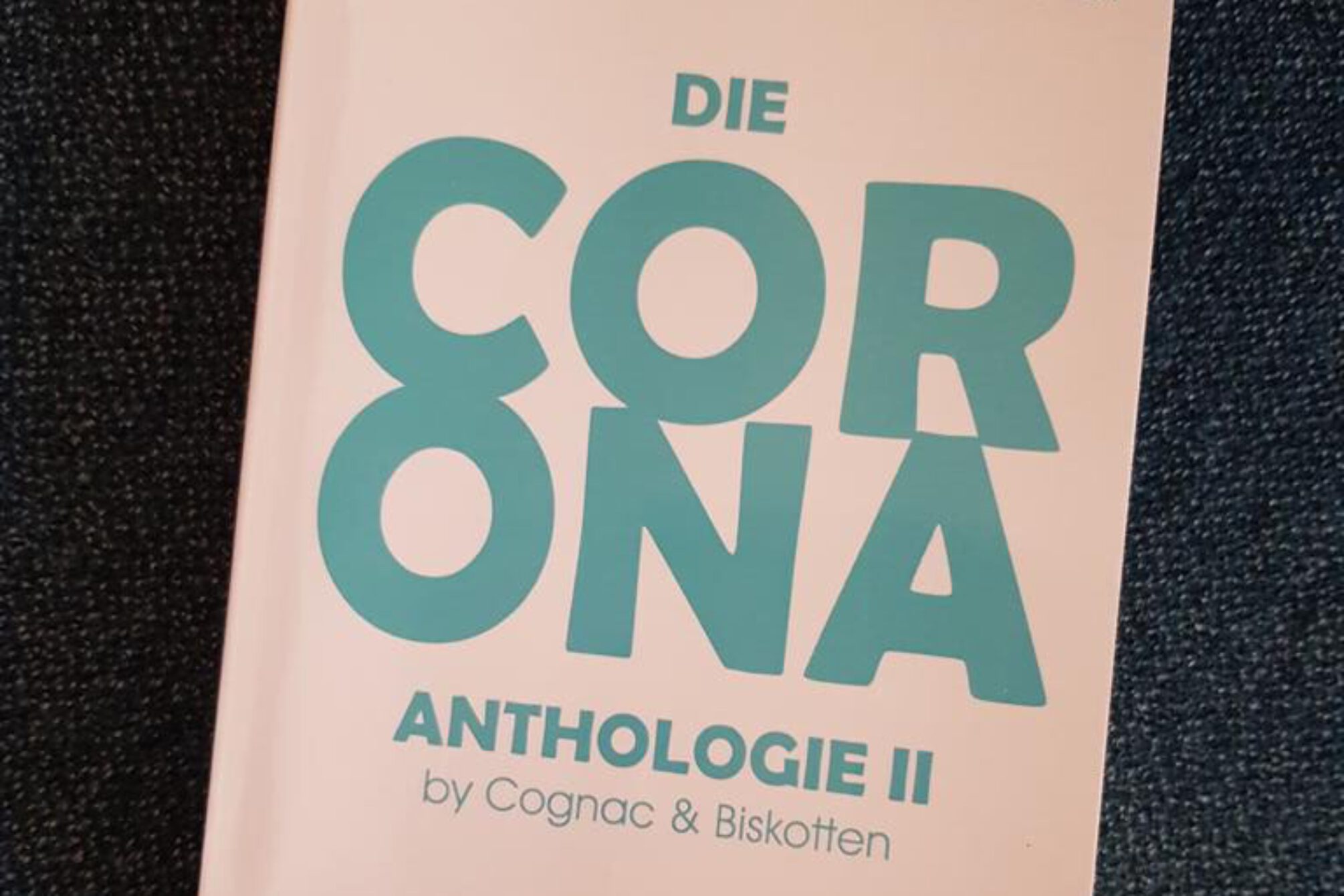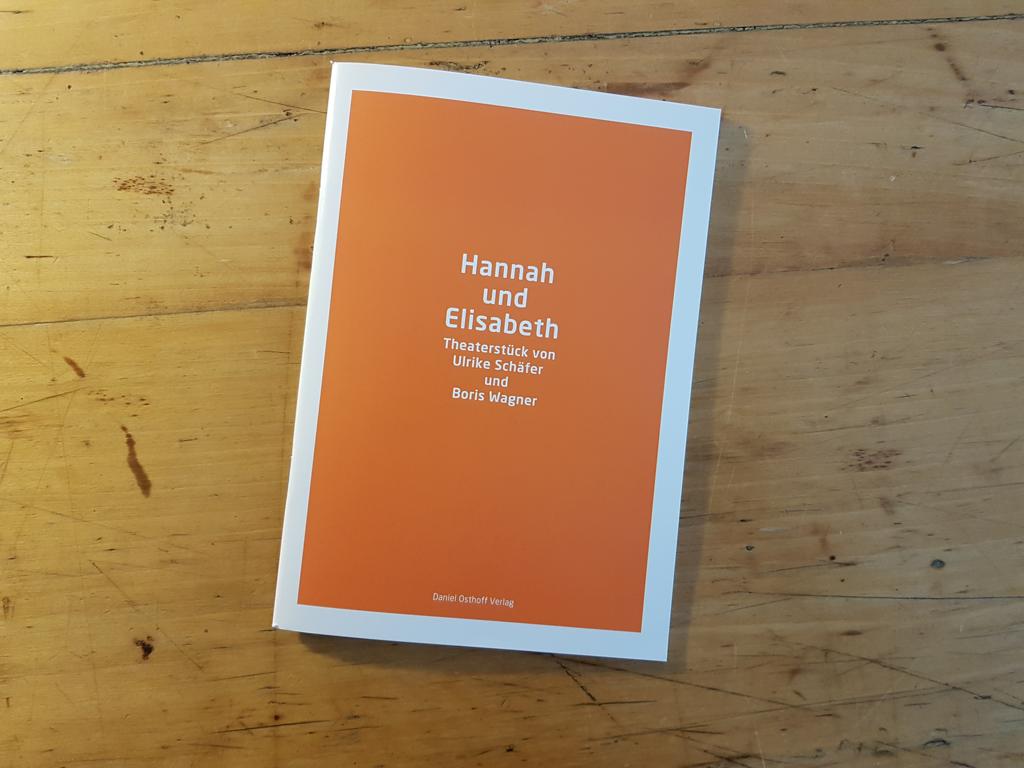Am Donnerstag, 28. November 2019 um 19 Uhr lesen Johannes Jung, Ulrike Sosnitza, Corina Kölln, Hanns Peter Zwißler und ich im Würzburger Kunsthaus Michel (Semmelstr. 42) aus unserem gemeinsamen Fortsetzungsroman “Für immer Elisa. Die unerhörten Ereignisse eines fränkischen Sommers”, der im Sommer in der Main-Post erschienen ist. Moderiert wird die Veranstaltung vom Main-Post-Team Mathias Wiedemann und Alice Natter.
An diesem Projekt beteiligt zu sein, war eine höchst spannende Erfahrung für mich. Ich wollte schon im Sommer diese Erfahrungen einmal zusammenfassen, auch für mich selbst, und nehme jetzt die bevorstehende Lesung zum Anlass, das endlich zu tun.
Zunächst aber Spoiler-Warnung: Wer die entstandene Erzählung (bzw. Mini-Kürzest-Roman) noch nicht kennt, sie aber noch lesen oder bei unserer Veranstaltung hören möchte, sollte mit der Lektüre dieses Artikels noch warten. Denn zum einen verrate ich einiges über die Geschichte darin, zum anderen ist manches von dem, was ich beschreibe, vermutlich nicht zu verstehen, wenn man sie nicht kennt.
Überraschung per E-Mail
Liebe Frau Schäfer,
wir erfinden den Fortsetzungsroman neu, und es wäre wunderbar, wenn Sie dabei wären!
Die Idee: Jeden Samstag eine Folge im Wochenendteil der Main-Post, jede Folge von einer anderen Autorin, einem anderen Autor aus der Region.
So begann die Anfrage von Alice Natter und Mathias Wiedemann, die mich Anfang Juli erreichte, und ich war – skeptisch.
Wir hatten etwas Vergleichbares vor Jahren im Autorenkreis Würzburg probiert. Nicht dass es freudlos war, aber das Ergebnis fand ich damals ausgesprochen dürftig. Was nicht schlimm war, es war ein Spiel, und wir stellten die einzelnen Folgen nur auf unsere Autorenkreis-Seite, wo sie eine Weile auf der Startseite blieben und dann im Dickicht des Web verschwanden. Aber gedruckt? In der Main-Post? Und ohne zu wissen, mit wem man da zusammen schreibt?
Ich weiß noch, ich wartete bis auf den letzten Drücker – und sagte dann doch zu. Die Neugier überwog, und irgendwann wusste ich, dass ich mich hinterher ärgern würde, wenn ich das Experiment ausschlagen würde – mehr, als wenn ich zusagte und es schiefging.
Und so waren die Rahmenbedingungen:
Ein Team-Mitglied macht den Anfang und schreibt die erste Folge. Wer welche weitere Folge übernimmt, wird zuvor vereinbart. Jede Autorin, jeder Autor bekommt die vorausgehenden Folgen, sobald sie bei der Main-Post abgegeben wurden, mindestens jedoch eine Woche vor dem eigenen Abgabetermin. D. h. jedes Team-Mitglied hat mindestens eine Woche Zeit, um die Geschichte fortzuschreiben, mit Glück auch etwas mehr. Umfang 9.000 bis 10.000 Zeichen. Titel: Die unerhörten Ereignisse eines fränkischen Sommers. Ansonsten war alles offen. Genre, Figuren, Handlung frei wählbar.
Fünf weitere Autorinnen und Autoren sagten zu, drei davon kannte ich bereits gut: Johannes Jung und Ulrike Sosnitza vom Autorenkreis Würzburg sowie meinen liTrio-Kollegen Hanns Peter Zwißler aus Schweinfurt. Von Corina Kölln hatte ich zumindest gehört bzw. gelesen, außerdem war noch der Schweinfurter Autor Lothar Reichel mit an Bord. Ich war verantwortlich für die dritte Folge und kannte meinen Vorgänger und meinen Nachfolger: Johannes Jung und Hanns Peter Zwißler. Das war schon mal gut.
Was ich vorausschicken kann: Die Kommunikation mit den Main-Post-Verantwortlichen war eine Freude, und die kollegiale Disziplin war, soweit ich sie mitbekommen habe, vorbildlich. Corina Kölln machte den Anfang, und bevor wir noch die Terminpläne bekamen, hatte sie offenbar bereits abgegeben. Johannes Jung legte turboschnell nach, sodass ich viel früher als erwartet (und eingeplant) die ersten beiden Folgen auf dem Tisch liegen hatte.
Und dann begann das Schwitzen.
Dann mach mal einen Plan …
Es kommt ja immer anders, als man denkt – selbst wenn man mit dem Unerwarteten rechnet. Die erste Überraschung war, dass die Handlung in zwei Zeit-Ebenen angelegt war – was sich bei arbeitsteiligem Schreiben ohne vorherige Abstimmung schon mal ziemlich ambitioniert anfühlte – und dass eine davon in den Fünfzigerjahren spielte.
Die zweite Überraschung: Johannes Jung ließ seine Folge mit einem klassischen Cliffhanger enden, welcher mir die schöne Frage bescherte:
Besteigt die Hauptfigur Werner im Jahr 1956 in Wertheim ein Gütermotorschiff und fährt als Decksmann mit dem Binnenschiffer mit, um Elisa wiederzufinden – oder nicht?
Fünfzigerjahre, Gütermotorschiff: Volltreffer. Genau meine Kragenweite.
Das Problem: Ich bin eine fatale Kombination aus weltfremd und pingelig. Wo andere noch mittels Allgemeinwissen und Chuzpe Szenerien mal eben so aus dem Handgelenk schütteln, durchsuche ich schon panisch das Internet und habe keinen Zentimeter Beinfreiheit, muss jedem einzelnen Satz erst mal den Boden bereiten – und wehe, da wackelt was!
Will sagen: Ich musste erst einmal das Wort “Gütermotorschiff” googeln, um sicher zu sein, dass es das bedeutet, was ich vermutete. Von dort bis zu den Fünfzigern ist es dann noch ein paar Kilometer hin. Und die Uhr tickte.
Andererseits: Flucht war keine Option – oder jedenfalls die allerschlechteste. So wie die zweite Folge endete, war klar, dass so ziemlich alle Leser – zu Recht – enttäuscht wären, wenn Werner das Schiff nicht besteigen würde.
Nun gab es gleich mehrere Glücksfälle. Zum einen hatte ich das Glück, kurzfristig mehr Zeit freischaufeln zu können, als ich für den Fortsetzungsroman eigentlich eingeplant hatte; mit Recherche-Aufwand hatte ich dafür überhaupt nicht gerechnet.
Zum anderen gibt es dieses Internet, und das führt einen nicht nur zu ungeahnten Informationsquellen, sondern auch zu Menschen. In diesem Fall zu weiteren Glücksfällen.
Unbekannte Welten
Wer sich für Binnenschifffahrt interessiert, dem empfehle ich den wunderbaren Blog “Die Binnenschifferin” von Nina Märtens. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich zumindest schon mal eine Vorstellung davon bekam, wie es sich heutzutage auf einem Gütermotorschiff reist und arbeitet, und habe Wörter wie Gangbord und Aufschießen kennengelernt.
Nur eben: Zu den Fünfzigern war der Weg immer noch weit.
Es ist immer wieder schön mitanzuschauen, wie einen das Schreiben aus der eigenen Komfortzone treibt. Bei mir: die Sache mit dem Leute-Fragen.
Soweit es geht, versuche ich Recherche suchend und lesend zu betreiben. Ich scheue davor zurück, wildfremde Menschen anzuschreiben oder gar anzurufen und um Hilfe zu bitten. Ich denke immer: Stör die Leute nicht bei ihren ernsthaften Verrichtungen mit deinem fluffigen Schreibkram. Was eigentlich merkwürdig ist, denn nach meiner bisherigen Erfahrung freuen sich die meisten, wenn sich jemand für das interessiert, was sie tun. Dennoch, meine Scheu hält sich hartnäckig. Aber manchmal muss es sein, und das ist gut so.
Also setzte ich mich einen Nachmittag lang hin und schickte Mails. Viele Mails. Die Uhr tickte, und es blieb auch nach Internet-Recherche noch viel Stochern im Nebel: Wo würden sich Ansprechpartner finden, die schon in den Fünfzigerjahren auf den Schiffen unterwegs waren oder die die Arbeit damals zumindest aus Erzählungen kennen? Je mehr ich anschrieb, desto größer war die Chance, dass einer darunter war, der bereit und in der Lage war, mir weiterzuhelfen. Oder jemanden kannte. Oder mir zumindest antwortete.
Was soll ich sagen. Die Reaktion war durchschlagend.
Wunder der Recherche
 Und so saßen mir am darauffolgenden Samstag im Vereinsheim in Himmelstadt gleich drei Mitglieder des Schiffervereins Mittelmain gegenüber und beantworteten geduldig meine seltsamen Fragen.
Und so saßen mir am darauffolgenden Samstag im Vereinsheim in Himmelstadt gleich drei Mitglieder des Schiffervereins Mittelmain gegenüber und beantworteten geduldig meine seltsamen Fragen.
Gerhard Kuhn vom Binnenschifferforum telefonierte mit mir mehrere Male, während er unterwegs war – natürlich auf einem Gütermotorschiff. Er fuhr gerade Richtung Bonn, als er meinen Textentwurf noch einmal gegenlas und auf sachliche Fehler prüfte.
Recherche ist mühsam, und Recherche ist schön. Das Schöne ist meistens vor allem das, was einem Menschen von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und das Schöne ist das Glück des Findens.
So hat zum Beispiel die Welt so etwas Wunderbares wie Orderstationen eingerichtet. Bevor ich noch irgendetwas wusste, wusste ich – oder wünschte mir -, dass Werner aufs Schiff eine Botschaft übermittelt bekommt. Aber wo? Und wie? Antwort: Orderstationen! Der ideale Schauplatz. Nicht am schnöden Telefon. Per Lautsprecher über den Rhein schallt sie, die Nachricht! So etwas kann man nicht schöner erfinden, als es einem die wirkliche Welt anbietet. Man muss nur suchen. Ohne so genau zu wissen, wonach eigentlich.
Schreiberfahrung der neuen Art
Und wie war es dann, das Schreiben selbst? Als Teil eines Teams? An einer Geschichte, die man nicht gewählt hat?
Jedenfalls anders als gedacht. Hier der Versuch einer Zusammenfassung:
• Es gelingt besser als erwartet – jedenfalls war es so bei diesem Experiment -, mich auf eine Geschichte einzulassen, die ich nicht geschrieben hätte und die ich vor allem nicht so geschrieben hätte, wie sie meine Vorgänger mir in die Hände gaben (natürlich nicht – jeder von uns schreibt anders). Wie kann das gehen? Natürlich über die Figur, nämlich dann, wenn ich sie ernst nehme, ihre Emotionen ernst nehme, nicht mehr frage: Glaube ich das, sondern: Was wäre wenn? Wenn ich mich auf sie einlasse. Um sie auf meine Weise weiterzuerzählen.
• Wenn man es ernstnimmt, ist das Schreiben in so einem arbeitsteiligen Projekt wirklich, wirklich knifflig. Und dabei meine ich gar nicht die Recherche, das war das nervenaufreibende Sahnehäubchen in diesem speziellen Fall. Sondern die Sache mit der Dramaturgie. Man muss – bei aller Offenheit des Handlungsverlaufs – überlegen, wo in der Geschichte die eigene Folge steht, was jetzt dramaturgisch ansteht, was man noch nicht vorwegnehmen darf usw. Man muss Dinge mitbedenken für die Nachfolgenden. Johannes Jung und ich haben beispielsweise beide den Gegenwarts-Strang der Handlung sozusagen “durchgeschleppt”, auch wenn er in unseren Folgen keine Funktion hatte, einfach um ihn für die Nachfolgenden warmzuhalten, ihn bei den Lesern nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es war klar – oder doch zumindest sehr wahrscheinlich -, dass spätestens in der letzten Folge in der Gegenwart etwas Einschneidendes geschieht, etwas, das sozusagen zum Herz der Geschichte gehört und sie schließt.
• Man muss Spuren legen – oder kann es zumindest -, darf aber die Nachfolgenden nicht einengen. In meinem Fall war die Figur Karin so eine Spur, die Werner während seiner Zeit als Decksmann kennenlernt. Einer meiner Nachfolger hätte daraus Werners spätere Ehefrau machen können. Das wollte ich ermöglichen, aber auf keinen Fall vorgeben, das wäre in Folge 3 noch zu früh gewesen. Immerhin war rein theoretisch sogar denkbar, dass Elisa selbst Werners Ehefrau wurde – völlig ausschließen konnte man das zumindest meiner Lesart nach anhand der ersten Folge nicht.
• Man muss sich entscheiden: Soll man Dinge geraderücken, die einen stören, oder sie auf sich beruhen lassen? Meine erste Idee war, Werner eine Schwester an den Hals zu schreiben (er hatte ja welche, das war in Folge 1 angelegt), die ihm in den Siebzigerjahren seine Exotisierung Elisas ordentlich um die Ohren haut. Nette Idee, bei genauerem Nachdenken zu egoistisch. Will man die Geschichte im Ganzen gelingen lassen, darf man das Risiko für die Nachfolger nicht mutwillig hochschrauben, Entscheidungen treffen, die dann dramaturgisch zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führen, nach dem Motto: nach mir die Sintflut. Letztendlich war für mich der bessere Weg, den Kern der Geschichte – Junge liebt Mädchen, Junge verliert Mädchen, Junge sucht Mädchen – ernst zu nehmen und weiterzuverfolgen, auf meine Weise.
Und was ist dabei herausgekommen?
Das Resultat, die Gesamtgeschichte, ist besser, als ich erwartet hatte. Natürlich hat jede Folge einen anderen Sound – das ist ja der Witz dieses speziellen Projekts, dessen Idee ja gerade nicht war, die Autor_innen und ihre Eigenheiten hinter der Geschichte verschwinden zu lassen. Natürlich schlenkert die Handlung, schert mal hier, mal da aus. Die Geschichte als Ganzes würde so natürlich keiner der Beteiligten geschrieben haben, und sie hätte sicherlich keines unserer persönlichen Gateways und Qualitätskriterien überstanden. Natürlich gab es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht nur wohlwollende Rückmeldungen (obwohl unerwartet viele), sondern auch Naserümpfen. Alles andere hätte mich überrascht, das war sozusagen eingepreist. Ich selbst aber weiß ja, was alles gutgehen muss, damit das herauskommt, was herausgekommen ist – und was alles schiefgehen kann! Ich kann der Geschichte bei allen Schlenkern ansehen, dass da wesentlich erfahrenere Autoren am Werk waren, als wir es damals vor Jahren, bei unserem Autorenkreis-Spiel-Projekt, waren.
Würde ich es wieder tun?
Stand heute: Ja! Es kann zwar jede Menge Stress erzeugen, ist aber auch spannend, auch fürs eigene Schreiben, gerade weil es einem Dinge abverlangt, die man nicht gewählt hätte.
Gibt es Grenzen?
Eng wird es sicherlich, wenn die eigenen Wertvorstellungen gebrochen werden. Das genauer auszuführen, verdient eigentlich einen eigenen Artikel; denn natürlich heißt es nicht, dass man nicht Figuren erzählen könnte – und wollte -, die (in den Augen der Autorin) “böse”, vorurteilsbeladen, diskriminierend oder ähnliches sind. Die Frage ist, in welcher Erzählhaltung dies geschieht, genauer: welche Haltung die erzählende Instanz (was nicht dasselbe ist wie die Autorin) zu ihnen einnimmt. Aber wie gesagt, das verdient noch einmal genauere Betrachtung – ich kann es hier nur antippen.
Und was könnte das Experiment noch reizvoller machen?
Das könnte so aussehen: Die Autor_innen eint, dass sie der Dramaturgie der Geschichte einen hohen Stellenwert geben. Sie haben alle großes Interesse daran, wie Geschichten “gebaut” sein können, auch ganz handwerklich. Das hört sich mechanistisch an, muss aber im Ergebnis keineswegs so wirken.
Es ist ja so: In diesem Fall gibt es, anders als sonst, keine Chance der Überarbeitung der Gesamtgeschichte. Bei einem “normalen” Schreibprojekt würde die Arbeit nach der Rohfassung erst richtig beginnen, meist in etlichen Umarbeitungs- und Überarbeitungsschritten. Hier aber sind zwar die einzelnen Folgen möglicherweise von den einzelnen Autor_innen mehrfach überarbeitet, die Geschichte als Ganzes jedoch nicht.
Soll das Ergebnis dennoch so gut wie möglich sein, kann ich mir das nur über die Dramaturgie vorstellen: Sie muss im ersten Wurf “sitzen”. Das geht nur, wenn man einander in dieser Hinsicht möglichst gut versteht: zum Beispiel an der richtigen Stelle Spuren legt oder wiederum Spuren entsprechend deutet, die die Vorgänger gelegt haben, sie aufgreift und dramaturgisch weiterführt. Ich stelle es mir höchst interessant vor, gemeinsam (aber ohne jede Abstimmung untereinander) zu versuchen, dabei möglichst weit zu kommen und eine möglichst stimmige Gesamtgeschichte zu entwickeln.
Nicht dass das im Elisa-Experiment überhaupt nicht der Fall gewesen wäre. Das war es durchaus, sonst wäre die Geschichte abgestürzt. Ulrike Sosnitza erwähnte beispielsweise im Interview, dass sie in ihrem abschließenden Part Zugeständnisse machen musste, die sie sonst nie eingehen würde: Vor allem musste sie auf engem Raum viele Informationen in den Text einbauen, die sie normalerweise viel eleganter streuen würde. Aber in diesem Fall hatte sie die Aufgabe, die Geschichte abzuschließen, sie rund zu machen, und das in wenigen Zeilen. Das war für sie wichtiger als die elegante Schreibe.
Eine dramaturgisch gut gebaute Geschichte als Ziel: Ein Team zusammenzustellen, in dem sich alle explizit und im Vorhinein darauf einigen und auch voneinander wissen, dass sie in dieser Hinsicht ähnlich ticken, daran Spaß haben und darin Ehrgeiz entwickeln, stelle ich mir höchst reizvoll vor.
Last but not least: DANKE!
 Aber zurück zum Elisa-Projekt: Dafür gilt es DANKE zu sagen. Zuallererst natürlich an Mathias Wiedemann und Alice Natter von der Main-Post dafür, dass sie dieses Projekt ausgeheckt und wie sie es mit uns umgesetzt haben. Die Zusammenarbeit war wirklich eine Freude. Dann an die Mit-Schreibenden, die so umstandslos, ja lautlos ein kollegiales Team gebildet haben.
Aber zurück zum Elisa-Projekt: Dafür gilt es DANKE zu sagen. Zuallererst natürlich an Mathias Wiedemann und Alice Natter von der Main-Post dafür, dass sie dieses Projekt ausgeheckt und wie sie es mit uns umgesetzt haben. Die Zusammenarbeit war wirklich eine Freude. Dann an die Mit-Schreibenden, die so umstandslos, ja lautlos ein kollegiales Team gebildet haben.
Und schließlich an die vielen Menschen, die mir in kürzester Zeit Rückmeldung zu meinen Recherche-Fragen gegeben und Hilfe angeboten haben. Einige habe ich schon genannt, geantwortet hatten mir noch mehr. Die Tasse des Schiffervereins Mittelmain steht auf meinem Schreibtisch, daneben liegt der Jubiläumsband, den mir die MSG geschickt hat, aufgeschlagen auf Seite 73: Ein Schiffer-Paar steht auf einem Gütermotorschiff, aufgenommen in den Fünfzigerjahren. Was war das für eine spannende Reise für mich durch die Tiefe der Zeit, auf die Flüsse … Allein dafür hätte es sich schon gelohnt.
Bleibt noch zu wünschen: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!